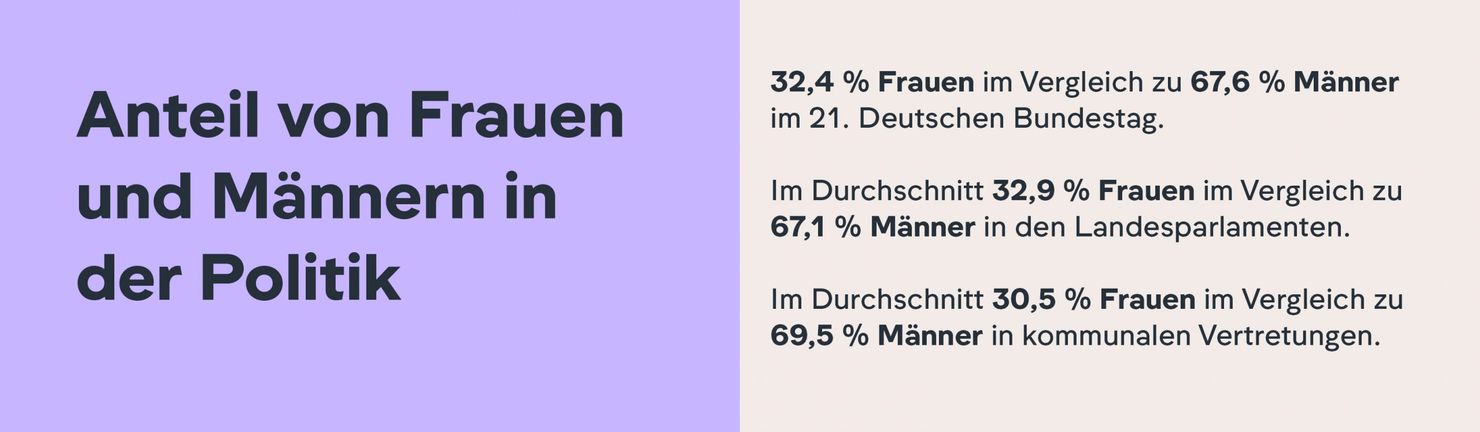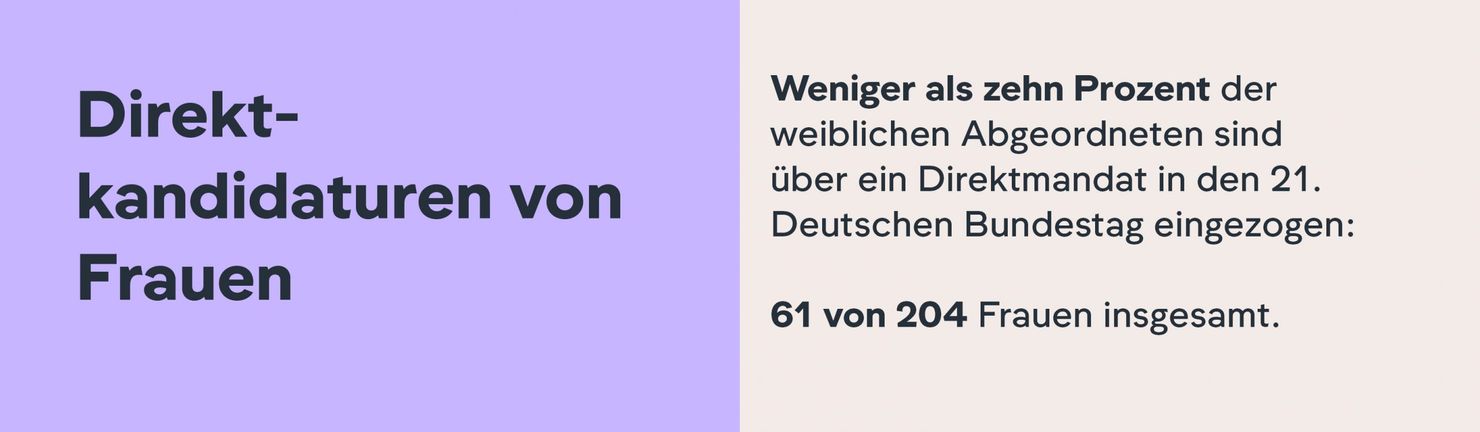AfD – Alternative für Deutschland (2025): Bundessatzung (Abruf: 31.3.2025).
Blome, Agnes/Müller, Kai-Uwe (2021): Gekommen, um (unterrepräsentiert) zu bleiben? Frauenanteil im Deutschen Bundestag stagniert seit über 20 Jahren bei einem Drittel. In: DIW Wochenbericht 88(43), S. 711–719.
BMI – Bundesministerium des Innern und für Heimat (2025): Dienstaltersliste der Regierungschefs der Länder (Abruf: 17.11.2023).
Bock, Jessica (2018): Parlamentarische Entwicklungen in beiden deutschen Staaten, Bundeszentrale für politische Bildung (Abruf: 31.3.2025).
Bpb – Bundeszentrale für politische Bildung (2017): Frauenanteil im Deutschen Bundestag (Abruf: 31.3.2022).
Bpb – Bundeszentrale für politische Bildung (2022): Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer (Abruf: 29.10.2022).
Bundesregierung (2023): Das Bundeskabinett (Abruf: 16.5.2023).
Bundeswahlleiter (2022): Statistik Dossier Reform des Bundeswahlrechts (Abruf: 30.10.2022).
Bündnis 90/Die Grünen (2022): Grüne Regeln. Satzung Bundesverband (Abruf: 28.6.2023).
BVerfG – Bundesverfassungsgericht (2017): Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 – BvR 2019/16 -, Rn. 1-69 (Abruf: 2.11.2022).
BVerfG – Bundesverfassungsgericht (2020): Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2020 – 2 BvC 46/19 -, Rn. 1-120 (Abruf: 1.9.2022).
CDU (2025): Statutenbroschüre der CDU Deutschlands, Volkspartei der Zukunft: Die CDU erneuern. Beschluss des 35. Bundesparteitags der CDU Deutschlands (Abruf: 31.3.2022).
CSU (2019): Näher am Menschen – Satzung der Christlichsozialen Union (Abruf: 8.11.2023).
Deutscher Bundestag (2017): Abgeordnete der 18. Wahlperiode 2013-2017 (Abruf: 29.10.2022).
Deutscher Bundestag (2021): Der Bundestag wird weiblicher und jünger (Abruf: 29.8.2022).
Deutscher Bundestag (2022): Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit (Abruf: 2.11.2022).
Deutscher Bundestag (2023): Sitzverteilung des 20. Deutschen Bundestages (Abruf: 16.11.2023).
Deutscher Bundestag (2025a): Abgeordneten-Statistik: Der neue Bundestag in Zahlen (Abruf am 31.3.2025).
Deutscher Bundestag (2025b): Sitzverteilung des 21. Deutschen Bundestages (Abruf: 31.3.2025).
Die Linke (2022): Bundessatzung, Die Linke (Abruf: 28.6.2023).
Europäisches Parlament (2024): Europäische Union – Geschlechterverhältnis der Mitglieder nach Land – 2024 (Abruf: 1.4.2025).
FDP (2019): Beschluss des Bundesvorstandes: Chancen durch Vielfalt – Ziele und Vereinbarungen (Abruf: 30.10.2022).
Ferner, Elke (2022): Gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern, Kommissionsdrucksache 20(31)06 (Abruf: 17.5.2023).
Gleichstellungsatlas (2025): Digitaler Gleichstellungsatlas, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Abruf: 31.3.2025).
Gleichstellungsbüro Stadt Göttingen (2022): Halbe-halbe! Parität in den Parlamenten – zum Stand der Dinge (Abruf: 22.11.2022).
Helene Weber Kolleg (o. J.): Neue Wege gehen: Modelle und Umsetzungsbeispiele aus anderen Ländern, Die ersten Paritätsgesetze (Abruf: 17.5.2023).
Helene Weber Kolleg (2024): Frauen Macht Politik (Abruf: 31.3.2025).
Hunt et al. (2018): Delivering Through Diversity, McKinsey & Company (Abruf: 1.4.2025).
IPU Parline (2025): Monthly ranking of women in national parliaments. Global data on national Parliaments 1st. March 2025 (Abruf: 1.4.2025).
Kletzing, Uta/Lukoschat, Helga (2010): Engagiert vor Ort: Wege und Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen (Abruf: 30.10.2022).
Landesfrauenrat Berlin (o.J.): Initiative #ParitätJetzt! (Abruf: 22.11.2022).
Landtag Brandenburg (2019): Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes: Parité-Gesetz vom 12. Februar 2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (Abruf: 2.11.2022).
Landtag Thüringen (2019): Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes – Einführung der paritätischen Quotierung, Drucksache 6/6964 (Abruf: 2.11.2022).
Laskowski, Silke (2022): Gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern im Deutschen Bundestag, Kommissionsdrucksache 20(31)07 (Abruf: 17.5.2023).
Laskowski, Silke Ruth (o.J.): Pro Parité! Ohne gleichberechtigte Parlamente keine gleichberechtigten Gesetze und keine gleichberechtigte Gesellschaft! In: Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes 3/2014, S. 93-103.
Lukoschat, Helga/Belschner, Jana (2019): Macht zu gleichen Teilen. Ein Wegweiser zu Parität in der Politik (Abruf: 17.5.2023).
Lukoschat, Helga/Köcher, Renate (2021): Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen. Eine empirische Untersuchung mit Handlungsempfehlungen an die Parteien (Abruf: 16.5.2023).
Lukoschat, Helga/Lohaus, Stefanie/Weidhofer, Cécile (2019): Mehr Frauen in die Parlamente! Informationen über und Argumente für Paritätsgesetze in Bund und Ländern (Abruf: 16.5.2023).
Riede (2023): Diversität als demokratische Intervention. Die Vermittlung von Vielfalt und egalitärer Teilhabe und ihre Kritik (Abruf: 1.4.2025).
Saar-SPD (2022): Regierungsprogramm der Saar-SPD 2022-2027 (Abruf: 22.11.2022).
SPD (2021): Organisationsstatut – Wahlordnung, Schiedsordnung, Finanzordnung (Abruf: 8.11.2023).
Statista (2023): Europäische Union: Frauenanteil in den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2023 (Abruf: 1.4.2025).
Statista (2021): Anteil der Frauen an den Mitgliedern der politischen Parteien in Deutschland am 31. Dezember 2021 (Abruf: 31.3.2025).
UN Women Afrika (o.J.): Rwanda: Women, Peace and Security (Abruf: 1.1.2025).
VerfGBbg – Verfassungsgericht Brandenburg (2019): Urt. v. 23. Oktober 2020 – VfGBbg 9/19 (Abruf: 2.11.2022).
VerfGH – Thüringer Verfassungsgerichtshof (2020): Urt. v. 15.07.2020 – VerfGH 2/20 (Abruf: 2.11.2022).
Wahlrechtskommission des Deutschen Bundestages (o.J.): Paritätsregelung per Gesetz und mildere Eingriffe erörtert, siehe auch vertiefend Einzelstellungnahmen der Sachverständigen der Wahlrechtskommission zum Thema Parität (Abruf: 22.11.2022).